Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft
Lehrstuhl für Germanistische Sprachwissenschaft
Adresse
Bismarckstraße 191054 Erlangen
Kontakt
- E-Mail: gerling-sekretariat@fau.de
- Telefon: +49 9131 85 22420
Leitung

Prof. Dr. Mechthild Habermann
Raum: Raum B3 A6
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen

Judith Willberg, M.A.
Raum: Raum C 207
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Lehrbeauftragte

Dr. Eva Büthe-Scheider
Raum: Raum C2 A5
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen

Dr. Jussara Paranhos Zitterbart
Raum: Raum C2 A5
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Bismarckstraße 1
91054 Erlangen
Akademie-Projekt: Fränkisches Wörterbuch
Website des Projekts: https://wbf.badw.de
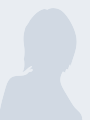
Jennifer Kurz
Sekretariat Fränkisches Wörterbuch
Raum: Raum 0.008
Bismarckstraße 6
91054 Erlangen
Raum: Raum 0.008
Bismarckstraße 6
91054 Erlangen
GRK 2839: Die Konstruktionsgrammatische Galaxis
Website des Projekts: https://www.phil.fau.de/forschung/agilefs/konstruktionsgrammatische-galaxie/
DFG-Projekt: Kommunikation und Sprache im Reich. Die Nürnberger Briefbücher im 15. Jahrhundert
Website des Projekts: https://lme.tf.fau.de/research/research-groups/computer-vision/briefbuecher/
Ehemalige Nachwuchsforschergruppe Flexible Schreiber in der Sprachgeschichte
Website des Projekts: http://www.copadocs.de
Professoren im Ruhestand
Weder Personen-IDs, Funktion+OrgNr, noch Kategorie wurden angegeben
Es konnte kein Kontakteintrag mit der angegebenen ID 373 gefunden werden.
Prof. Dr. Horst Haider Munske
Lehrstuhl für Germanische und Deutsche Sprachwissenschaft und Mundartkunde (1975-2004)
Raum: Raum Sprachatlas, Raum 0.005
Bismarckstraße 6, EG rechts
91054 Erlangen
Raum: Raum Sprachatlas, Raum 0.005
Bismarckstraße 6, EG rechts
91054 Erlangen
Ehemalige
Es konnte kein Kontakteintrag mit der angegebenen ID 385 gefunden werden.- Ling VM-Hauptseminar: Bereich Gegenwartssprache/DaF (in Erlangen, nur für BA und LA Gym)
- Ling VM-Hauptseminar: Bereich Gegenwartssprache/DaF (in Nürnberg, nur für LA GS, MS, RS, Berufl. Schulen)
- Ling VM-Hauptseminar: Bereich Sprachwandel/Variation (in Erlangen, nur für BA, LA Gym, LA Berufliche Schulen): Was ist eigentlich mittelalterliches Deutsch?
- Ling VM-Hauptseminar: Bereich Sprachwandel/Variation (in Erlangen, nur für BA, LA Gym und LA Berufliche Schulen)
- M-LingGram - HS: Grammatik und Lexikon: Theorie und Anwendung, aus Muttersprachen- und DaF-Perspektive
- M-LingHist - HS: Historische Linguistik und Sprachwandel
- Ling Exam: Examenskurs Linguistik (Erlangen, nur LA Gym)
- Ling Exam: Examenskurs Linguistik (Nürnberg, nur LA GS, MS, RS)
- Ling VM-Kolleg: Bereich Gegenwartssprache/DaF (Erlangen, nur für BA und LA Gym)
- Ling VM-Kolleg: Bereich Sprachwandel/Variation (in Erlangen, geöffnet für alle Studiengänge)
- Ling VM-Kolleg: Gegenwartssprache/DaF (Nürnberg, nur LA GS, MS, RS, Berufl. Schulen)
- Ling BM-2: Einführung in die historische Sprachwissenschaft (Erlangen, nur für BA, LA Gym, LA RS)
- Ling BM-2: Einführung in die historische Sprachwissenschaft (Nürnberg, nur LA GS, MS, RS)
- Ling BM-2: Geschichte der deutschen Sprache (Erlangen, geöffnet für alle Studiengänge)
- Ling BM-2: Geschichte der deutschen Sprache (Nürnberg, geöffnet für alle Studiengänge)
- M-LingMeth - HS: Methoden der Linguistik - empirisch, formal und computergestützt
- Ling Finit Kolloquium: BA-Arbeit und Schriftliche Hausarbeit (Erlangen)
- M-LingGram - UE: Grammatik und Lexikon: Theorie und Anwendung, aus Muttersprachen- und DaF-Perspektive
- M-LingHist - UE zum HS: Historische Linguistik und Sprachwandel
- M-LingMeth - UE zum HS: Methoden der Linguistik - empirisch, formal und computergestützt
Jeder Link führt zu einer Kurzbeschreibung des jeweiligen Schwerpunktes und damit verbundenen Projekten und Publikationen.
|
Historische Lexikographie
|
Heisenberg-Förderung: Heisenberg-Stelle
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Juli 2024 - 31. Juli 2024
Mittelgeber: DFG-Einzelförderung / Heisenberg-Programm (EIN-HEI)Europäischer Master für Lexikographie
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 2024 - 28. Februar 2030
Mittelgeber: Sonstige EU-Programme (z. B. RFCS, DG Health, IMI, Artemis)
URL: https://www.emlex.phil.fau.de/Der "Europäische Master fürLexikographie" (EMLex) richtet sich an Studierende, die ein großesInteresse an der Arbeit mit Wörterbüchern und lexikographischenOnline-Ressourcen haben. Der EMJM-EMLex bietet einen internationalen undinterdisziplinären Abschluss in Lexikographie. Der Masterstudiengangkonzentriert sich auf den Aufbau von Fachwissen in theoretischer undpraktischer Lexikographie, Digital Humanities, Sprachtechnologien, natürlicherSprachverarbeitung und künstlicher Intelligenz, die auf die Bedürfnisse einersich verändernden digitalen und globalen Gesellschaft ausgerichtet sind. Diebesonderen Merkmale des EMJM-EMLex sind seine internationale Ausrichtung, dieInteraktion zwischen Theorie und Praxis, die Förderung der Mehrsprachigkeit(Unterrichtssprachen: Deutsch und Englisch + Erwerb weiterer europäischerSprachen), innovative Lehr- und Lernansätze sowie ein umfassenderMobilitätsplan und eine enge Verbindung zur Privatwirtschaft und dem sozialenSektor. Zulassungsvoraussetzungen sind ein Bachelor-Abschluss in Studienfächernwie Geisteswissenschaften, Sprachtechnologien, Computerlinguistik und guteKenntnisse der deutschen und englischen Sprache. Die Studiendauer beträgt 4Semester (120 ECTS): Das 1. Semester konzentriert sich auf die Grundlagen derLexikographie, Sprachen und Soft Skills. Das 2. Semester ist einobligatorisches Mobilitätssemester an einer der Hochschuleinrichtungen. Das 3.Semester ist fortgeschrittenen Modulen und dem Praktikum gewidmet, das in engerZusammenarbeit mit Einrichtungen des sozialen Sektors und der Privatwirtschaftdurchgeführt wird. Das 4. Semester ist der Masterarbeit gewidmet. Dergemeinsame Abschluss wird von der Universidade de Santiago de Compostela, derFriedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Université de Lorraine(Nancy), der Universität Hildesheim, der Károli Gáspár Református EgyetemBudapest, der Universidade do Minho, der Università degli Studi Roma Tre undder Ilia State University verliehen. Der Studiengang wird von acht assoziiertenPartnereinrichtungen und zahlreichen Akademikern aus aller Welt unterstützt.„Sprachliche Zweifelsfälle im Deutschen“
(FAU Funds)Laufzeit: 1. Mai 2023 - 31. Dezember 2023Lehrprojekt im Kontext der Internationalisierung der Lehrkräftebildung, inklusive Studierendenworkshop in ParisFunctions and cognitive semantics of prepositions in complex constructions
(Drittmittelfinanzierte Gruppenförderung – Teilprojekt)Titel des Gesamtprojektes: GRK 2839: Die Konstruktionsgrammatische Galaxis
Laufzeit: 1. Oktober 2022 - 30. September 2027
Mittelgeber: DFG / Graduiertenkolleg (GRK)Fundamental work in cognitive linguistics has highlighted the role of space and spatial expressions to the cognitive organization of language (Talmy 1983, 2008, Lakoff and Johnson 1980), which resulted in a very detailed interest in the semantics of prepositions and their organization in semantic networks already quite early on (see Sandra and Rice 1995 for an overview and a critique). This project will be concerned with an analysis of German prepositions and the central role they play in the expression of space, time, instrumentality, and modality both in concrete and more abstract uses such as the so-called governed prepositions (see e.g. Breindl 1989 for a detailed account of prepositional objects). Recent constructional treatments of German prepositions, such as the ones by Rostila (2014, 2015, 2018) and Zeschel (2019) will provide the theoretical starting point. German constructions with prepositions such as mit ‘with’, unter ‘under’, zwischen ‘between’ and über ‘over’, um ‘round’, zu ‘to’ form semantic nests of similarity, which express roles such as PARTNER or TOPIC in the communication frame (e.g. with diskutieren ‘discuss’, sprechen ‘speak’, Diskussion ‘discussion’, Debatte ‘debate’) (compare the families of overlapping constructions with the preposition into, Herbst & Uhrig 2019). The aim of the project is to provide a corpus-based description of argument structure constructions with these prepositions and an illustration of the way they cluster, i.e. of overlap or links between the various constructions postulated, making use of semantic frames (e.g. German FrameNet) or image schemata. These descriptions, which will also consider aspects such as text types, cultural background etc., can then become entries of the general research constructicon, which is one common aim of the RTG. This part of the project addresses CON 1. (CON1: How do we identify constructions (what are their defining criteria; are they better seen as discrete units, prototypes, attractors in constructional space, or nodes in a network of cognitive associations)?) A contrastive analysis between selected German and English prepositions (in the spirit of Uhrig & Zeschel 2016) will be carried out to determine the extent of language-specific encodings (CON4: To what extent can constructions (and their constituents) identified in one language be equated with superficially similar constructions in another language?). This is directly related to the question of the degree of detail and item-specificity with which such prepositional constructions should be distinguished and stored in the mental constructicon and the reference constructicon (CON2: To what extent is constructional knowledge determined by the specific items occurring in them (colloprofiles) and how can we measure and operationalize the degree of lexical specificity vs. productivity of construction slots?), because if it turns out that uses across English and German are not predictable, a stronger role of storage will have to be assumed. More specifically, possible factors determining construction status will be investigated, including variables related to diachronic or regional variation, and weighted against factors such as individual differences (Dąbrowska 2012a, 2012b, 2015b) and socio-cultural conditions of the use of a construction (USE1: What factors influence speakers’ choices from a range of competing constructions?). The project will make use of various methodological approaches, including hermeneutic analysis of meaning and semantic similarity supported by judgments tests. Most importantly, however, the project will build on the corpus-analytic procedures described by Schierholz (2006) and Zeschel (2015) for the monolingual research and Uhrig & Zeschel (2016) for the contrastive aspects.German verbs with particles or prefixes in language change: Form, meaning, and syntax
(Drittmittelfinanzierte Gruppenförderung – Teilprojekt)Titel des Gesamtprojektes: GRK 2839: Die Konstruktionsgrammatische Galaxis
Laufzeit: 1. Oktober 2022 - 30. September 2027
Mittelgeber: DFG / Graduiertenkolleg (GRK)Word formation processes occupy a central position in constructional space in that they involve units which are small in size but nevertheless complex and because word formation processes are located between the lexical and syntactic poles of this space (cf. Felfe 2012, Michel 2014). However, studies on word formation in language change are rare. For this reason, we will address one key aspect of the diachronic emergence of verbs with particles and prefixes in this project. In the first phase, German verbs with durch-, hinter-, über-, um-, unter-, and wider- will be analysed with respect to their formal and semantic change from initially loose syntagms to stable word units. The change in the form-function pairs will be described alongside the variation and change of the syntactic constructions in which they are embedded. In accordance with Booij’s view (2010: 3) that word formation patterns are “abstractions over sets of related words”, and that complex words are based on constructional schemata, we are aiming to identify different levels of abstraction for the combinations analysed. In the second phase, we want to uncover the multifacetted network of the continuum of schematicity in diachrony by tracing the processes of idiomatization resulting in non-transparent expressions. In the third phase, the conditions of the spread of word formation change phenomena in the language will be analysed. Methodologically, this is an empirical research project based on the analysis of historical language corpora of
German. In addition to historical word formation research, approaches of Construction Grammar and Relational Morphology (Jackendoff & Audring 2020), grammaticalization research and valency grammar are drawn upon.
The first phase of the project will involve analysing data from historical language corpora of German such as the following: Deutsch Diachron Digital (DDD) Altdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank, GerManC, Deutsches Textarchiv (DTA) and DWDS. The analysis will include the description of all verbs with durch-, hinter-, über-, um-, unter-, and wider- to be found in these corpora. The development of the selected particles or prefixes will be studied phonologically and graphemically to determine grammaticalization processes (erosion, univerbization) diachronically. All of these verb combinations will be described (and annotated, wherever possible) morphologically (word formation base, separable particle or non-separable prefix, etc.) and syntactically (valency, semantic role, lexical filler of slots, syntactic collocations, topology). Subsequently, the individual verbs will be assigned to semantically defined schemas (e.g. ‘local’, ‘aspectual’) and subschemata defined by their specific word formation components and their syntactic environment. This part of the project will focus on the GRQ CON1 (How do we identify constructions – in this case, to what extent do word formation schemata differ from lexical items, and what is construction change in word formation?; cf. Hilpert 2013, Jackendoff & Audring 2020).The second phase of the project will deal with constraints on open slots in syntactic use and their semantic fixation on certain words: for example, in the construction x geht um, literally ‘x walks around’, the x slot was highly productive in MHG, whereas in NHG it is restricted to ein Gespenst ‘a ghost’, eine Seuche ‘a plague’, eine Liste ‘a list’ and a small number of related NPs. We will model the processes and degrees of idomaticity in meaning change in terms of a "continuum of schematicity" (Croft & Cruse 2004: 255). The data for different periods will be analysed synchonically before a diachronic analysis is attempted – cf. Habermann (in press). This part of the project will address the GRQs CON2 (How can we operationalize the degree of lexical specificity vs. productivity of construction slots?).A third aim of this research will ask to what extent some factors favour the spread of word formation constructions from individual use in particular situations, text types, or regions to more general use throughout society (as far as this can be seen historically). To find an answer to this question, the verbs of the text corpus will be described (and annotated) for frequency, with special attention paid to hapax legomena, taking into account factors such as individual usage (author), stylistic (text type) and regional context (see also Bybee 2015). (This latter aspect could be extended in a follow-up project in the second phase of the RTG.) This part of the project will address GRQs ENT1 (How do frequency, salience and dispersion influence entrenchment?) and USE4 (How do the factors communicative intentions, socioeconomic status, and dialect result in language change at the community level at different timescales?).Argument structure constructions in language contact: intransitive motion in Anglo-Norman
(Drittmittelfinanzierte Gruppenförderung – Teilprojekt)Titel des Gesamtprojektes: GRK 2839: Die Konstruktionsgrammatische Galaxis
Laufzeit: 1. Oktober 2022 - 30. September 2027
Mittelgeber: DFG / Graduiertenkolleg (GRK)Constructionist perspectives have been applied to phenomena of language contact and multilingualism only recently (e.g. Hilpert & Östman 2016, Boas & Höder 2018). A central idea here is the multilingual constructicon (instead of assuming separate systems for each language) which comprises both language-specific and language-unspecific constructions, as put forward, for instance, in Höder’s Diasystematic Construction Grammar (2018) in which contact-induced change is modelled as constructionalization, constructional change, and reorganization in the multilingual constructicon. The contact language to be investigated here is Anglo-Norman, i.e., the variety of French used in Britain from after the Norman Conquest to the early 15th century. Anglo-Norman developed several characteristics in which it differed from continental varieties of medieval French. Many of these features can be seen as effects of contact with Middle English, as is clearly visible at the phonological level. Anglo-Norman syntax, by contrast, has been argued to remain largely unaffected by language contact until the mid 14th century (Ingham 2012). This has been shown to be the case mostly for abstract syntactic phenomena such as V2, null subjects, or the clitic vs strong form distinction in object pronouns (Ingham 2012, 2010). Argument structure constructions, however, being more ‘meaningful’, might be expected to be more likely to change towards being less language-specific, particularly in a setting where many verbs are used in both languages anyway, and hence language-unspecific (cf. e.g. Durkin 2014 for the large scale borrowing of French lexis into Middle English). According to Schauwecker (2017), for instance, Anglo-Norman develops a resultative construction with legal speech act verbs, copied from Middle English (à la sentence someone to prison).One of the aspects in which medieval English and medieval French differ with regard to argument structure is the expression of intransitive motion (Huber 2017, Schauwecker & Trips 2018): Middle English often combines directional prepositional phrases and adverbs (“satellite-framing”) with manner of motion verbs (e.g. ride into the forest) or even non-motion verbs (e.g. toil into the forest), whereas medieval French avoids such combinations. Initial research points towards an Anglicization of Anglo-Norman motion expressions: Huber (in press) shows that the non-motion verbs travailler ‘toil’ and labourer ‘toil’ are attested in motion uses in Anglo-Norman since the late 13th century and Schauwecker’s analysis of four selected manner verbs finds them combined with directional complements (PPs with à and sur) more frequently in 12th to 14th century Anglo-Norman material than in continental French (Schauwecker 2019: 60–61) (cf. also Schøsler (2008: 207) who suspects directional adverbs to be more frequent in Anglo-Norman than in continental medieval French, and cf. more generally the work of the DFG-project BASICS (Stein & Trips, 2015–2021)).The aim of the project proposed here is to investigate motion constructions in Anglo-Norman in more detail, to find out to which degree these are influenced by contact with Middle English, and whether contact influence is felt earlier on the level of argument-structure-constructions than in more abstract syntactic characteristics of Anglo-Norman. This will be done by analyzing motion expressions in the Anglo-Norman textbase (c. 3 million words, various genres), the Anglo-Norman Yearbooks Corpus (c. 1.5 million words, narrative and dialogical sequences from court hearings) and perhaps the PROME database (c. 8 million words, trilingual parliament rolls) and other, not yet digitized Anglo-Norman texts (editions by the Anglo-Norman Text Society). The project addresses the following GRQs:- NET3 In multilingual speakers, are the different languages represented in different networks or one multilingual network? In particular, are constructional changes towards the Middle English model predominantly found with verbs used in both languages (e.g. gallop/galoper, hasten/haster), and hence happening on the level of the verb, or are we dealing with changes on the more schematic level of the argument-structure-construction?- USE4: How do the factors mentioned in USE1 and USE2 [here: multilingualism] result in language change at the community level at different timescales? Particularly [also related to USE3]: if the intransitive motion construction in Anglo-Norman is undergoing change to become more like the Middle English one, does this happen “sneakily” (De Smet 2012), i.e. first in more inconspicuous contexts (coordination with other motion verbs, perfect construction (resultative), reflexive pronoun)?Konstruktionen jenseits des Satzes: Textstrukturierung in historiographischen Texten (insb.) des 16. Jahrhunderts
(Drittmittelfinanzierte Gruppenförderung – Teilprojekt)Titel des Gesamtprojektes: GRK 2839: Die Konstruktionsgrammatische Galaxis
Laufzeit: 1. Oktober 2022 - 30. September 2027
Mittelgeber: DFG / Graduiertenkolleg (GRK)This project aims to apply the constructionist approach to units larger than the sentence, as suggested by Hoffmann & Bergs (2018) (see also Hoffmann 2015 and Hoffmann & Bergs 2015), in particular in the analysis of sixteenth-century Italian historiographical texts such as Machiavelli’s Istorie fiorentine (1525) and F. Guicciardini’s Storia d’Italia (1561). The textstructuring devices employed in these texts have not received much attention in previous research, since analyses tend to rely on modern editions, in which these texts appear typographically subdivided into smaller units, i.e. into chapters and paragraphs. These subdivisions, however, had only been introduced in 19th century editions, while the original versions, i.e. the 16th century prints, were nearly completely devoid of such typographic textstructuring devices. Nevertheless, the analyses proposed so far (cf. e.g. Blumenthal 1980, Nencioni 1984, Dardano 2017: 282–371) give reason to assume very close relationships between linguistic forms and text structuring functions, i.e. originally, text structuring (foreground vs. background; narration vs. comment; discourse-topic shift etc.; cf. Fesenmeier & Kersten 2018) seems to be expressed by certain recurrent lexicogrammatical patterns, which vary however considerably in size and complexity, for example sentence-initial ma ‘but’ without any adversative value, anaphoric coniunctio relativa-constructions, verb subject ordering, complex hypotactic structures with different types and degrees of subordination.
Traditionally, such lexicogrammatical patterns have been described as stylistic devices and often treated independently from one another. However, at least some of them seem to be related (e.g. coniunctio relativa + subordination + passive + present tense: [Le quali cose] [mentre che] … [si trattano]); moreover, the relation between the “grammatical” elements (determiners, subordinating conjunctions) and the “lexical” elements (e.g. encapsulating noun phrases such as cosa/cose ‘thing(s)’ which function “as a resumptive paraphrase for a preceding portion of a text” (Conte 1996: 1)) of such patterns does not always seem to be grasped in a satisfying manner.
Since one of the advantages of Construction Grammar as a theoretical framework is that the mechanisms developed to describe standard syntactic phenomena can be extended to higher levels of linguistic organization (cf. e.g. Östman 2005, Masini 2016: 75–78, Groom 2019, Hoffmann & Bergs 2018) and since previous work has clearly shown that linguistic conventions also exist at higher levels of linguistic organization, e.g. complexes of clauses revolving around the same discourse topic (cf. Nir & Berman 2010), it seems reasonable to assume the existence of constructions that function as schematic frames for the organization of discourse and whose details (grammatical structure, lexical elements etc.) can be described in a systematic way (CON1: How do we identify constructions – in particular: what are their defining criteria?).
Since Machiavelli’s Istorie fiorentine and Guicciardini’s Storia d’Italia present highly complex syntactic “architectures”, it seems promising to analyse both texts in the analytical framework of CxG, in particular with recourse to the concept of “clause packages”, i.e. “text-embedded units of one or more clauses connected by abstract linkage relations” (Nir & Berman 2010: 748, our italics). Following Berman & Nir-Sagiv (2009: 160), parameters of a more fine-grained analysis could be the number of clauses attached to a main clause, the different types of subordinate clauses, their ordering (in particular with respect to the main clause), and the overall structure (parataxis, hypotaxis etc.). As Machiavelli and Guicciardini strongly differ in their views on both history and historiography, it can be expected that such analyses reveal important differences in terms of clause packaging strategies, differences which in turn should reflect certain “epistemological” differences, just as “the epistemologies and phraseologies of academic disciplines” turned out to be “mutually constitutive” (Groom 2019: 315). The project will thus address GRQs USE1 (What factors influence speakers’ choices from a range of competing constructions?) and USE2 (To what extent do the factors determining the choice of construction differ between speakers with respect to their individual backgrounds and personalities?).
In the first stage of the project, the focus will be “synchronic”, i.e. it will involve an in-depth analysis of the two Italian 16th century texts (thereby applying the CxG framework to a “text-language” in the sense of Fleischman 1991: 252 n. 1, i.e. to a “dead language (langue de corpus), one for which all evidence derives from texts”). Nevertheless, it seems appropriate to also include a “diachronic” perspective by taking into account earlier/later historiographical texts in order to shed light on changes in clause packaging and organization of discourse (cf. the evidence given in Colussi 2014); this relates to GRQ USE4 (How do the factors mentioned in USE1 and USE2 result in language change at the community level at different timescales?). Furthermore, since both the Istorie fiorentine and the Storia d’Italia were translated into French in the 16th century, a contrastive analysis could equally allow for relevant insights in the (construction?) status of previously identified lexicogrammatical patterns in the original texts, since 16th century French does not display the same syntactic devices that can be found in 16th century Italian; therefore one might expect different recurring lexicogrammatical patterns in the two languages.Sakraler Text im Prozess: Martin Luthers Bibelübersetzung – Kognition, Produktion und Revision (Habilitationsprojekt)
(Projekt aus Eigenmitteln)Laufzeit: seit 30. Juni 2021Marianne-Plehn-Programm Ulrike Epple
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Oktober 2020 - 31. Juli 2022
Mittelgeber: Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst (StMWK) (seit 2018)Kommunikation und Sprache im Reich. Die Nürnberger Briefbücher im 15. Jahrhundert: Automatische Handschriftenerkennung - historische und sprachwissenschaftliche Analyse.
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Oktober 2019 - 30. September 2022
Mittelgeber: DFG-Einzelförderung / Sachbeihilfe (EIN-SBH)Kommunikation und Sprache im Reich. Die Nürnberger Briefbücher im 15. Jahrhundert: Automatische Handschriftenerkennung - historische und sprachwissenschaftliche Analyse
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Oktober 2019 - 31. März 2024
Mittelgeber: DFG-Einzelförderung / Sachbeihilfe (EIN-SBH)
URL: http://lme70.informatik.uni-erlangen.de:8060/exist/apps/nuernberger-briefbuecher/projektbeschreibung.htmlZiele des gemeinsamen Vorhabens von HistorikerInnen, SprachwissenschaftlerInnen und InformatikerInnen sind 1) die Untersuchung der Bedeutung der Reichsstadt Nürnberg für den Informationsaustausch im Heiligen Römischen Reich und 2) damit verbunden die Erforschung des Anteils dieser städtischen Kanzlei zur Entwicklung der neuhochdeutschen Schriftsprache. Hierfür wird 3) eine hybride Edition der Nürnberger Briefbücher – der kopialen Überlieferung nahezu aller ausgehenden Briefe des dort regierenden Kleinen Rates – von 1408 bis 1423 (mit insgesamt 844 Folia) erstellt. Zur erfolgreichen Umsetzung werden 4) die vorhandenen Mittel der automatischen Handschriftenerkennung und -analyse durch neuartige Fusionsmethoden weiterentwickelt und Best Practices erarbeitet; die Ergebnisse und Erfahrungen stehen anschließend zukünftigen Projekten zur Verfügung und werden Open-Source veröffentlicht.Mit der Edition der Nürnberger Briefbücher wird eine einzigartige Quelle für die Geschichte der Stadt wie auch für das spätmittelalterliche Reich erschlossen, deren großer historischer und sprachhistorischer Wert bislang nicht hinreichend erforscht wurde. Die zentrale Rolle Nürnbergs im reichsweiten Nachrichtenwesen und bei frühen sprachlichen Ausgleichsprozessen im Rahmen der Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache wurde immer wieder proklamiert, jedoch fehlt eine wissenschaftliche Untermauerung dieser Thesen auf Grundlage des vorhandenen Quellenmaterials. Aus historischer Perspektive werden die Themenvielfalt und die Kontaktpartner der Briefbücher als Spiegel des reichsstädtischen Kommunikationsnetzes im frühen 15. Jahrhundert untersucht, wofür mittels der automatischen Schrifterkennung darüber hinaus auch die Kontaktpartner der anschließenden Bände quantitativ erfasst werden. In linguistischer Hinsicht wird auf der Basis einer phonologisch-graphematischen Annotation die These von der frühen Überregionalität der Nürnberger Schreibsprache überprüft. In wechselseitiger Ergänzung mit den Historikern werden zudem Adressatenbezogenheit und Formelhaftigkeit der Briefbücher anhand sozio- und textlinguistischer Kriterien systematisch erschlossen.Erste Erfahrungen wurden bereits in einem Pilotprojekt zum ältesten Nürnberger Briefbuch (1404‒1408) mit ca. 800 Briefen gesammelt. Für die automatische Handschriftenerkennung wird die Wortfehlerrate der neuesten Technologie des Projektes READ (https://read.transkribus.eu/) durch die neuen Fusionsverfahren nochmals reduziert, wodurch der Transkriptionsprozess beschleunigt und gleichzeitig eine breitere Anwendbarkeit gesichert wird.Produktivität und Kreativität in der Lexik des Ostfränkischen
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Oktober 2018 - 30. September 2020
Mittelgeber: Fritz Thyssen StiftungDasProjektthematisiert die Frage, wie sich Dialekte in Richtung Regiolekte undStandardsprache weiterentwickeln und akkommodieren. Dieses Ziel steht imKontrast zur bisherigen Forschung, die weitgehend auf den Aspekt desDialektabbaus ausgerichtet ist. Im Projekt wird das lexikalische Potential vonDialektsprechern und -sprecherinnen in den Fokus gerückt: Erstmals wirdsystematisch am Beispiel des Ostfränkischen untersucht, was denWortschatzausbau im Dialekt steuert. DerAusbau des Dialektwortschatzes erfolgt auf dreierlei Weise: durch Wortbildung(Produktivität) sowie Bedeutungsbildung und Entlehnung (Kreativität). Alsprimäre Datenbasis dient das online verfügbare Material des Fränkischen Wörterbuchs, das Erhebungenaus den Jahren 1960–2001 enthält. Zur Ergänzung dieser Daten wird einvergleichendes Korpus ‚Dialektliteratur‘ aufgebaut und ausgewertet. ZurÜberprüfung der Ergebnisse werden kompetente Dialektsprecher und -sprecherinnenin Interviews befragt.Sprache, Reformation und Konfessionalisierung. 9. Jahrestagung der Gesellschaft für germanistische Sprachgeschichte
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 27. September 2017 - 30. September 2017
Mittelgeber: DFG-Einzelförderung / Sachbeihilfe (EIN-SBH)Nachwuchsforschergruppe "Der flexible Schreiber in der Sprachgeschichte. Zensierte Patientenbriefe des 19. Jahrhunderts
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. September 2017 - 31. August 2022
Mittelgeber: Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst (ab 10/2013)Flexible Schreiber in der Sprachgeschichte. Zensierte Patientenbriefe des 19. Jahrhunderts.
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: seit 1. September 2017
Mittelgeber: Elitenetzwerk BayernWir variieren ständig bei der Verwendung von Sprache. Dabei passen wir uns unterschiedlichen Situationen und Gesprächspartnern an, setzen Sprache gezielt ein, um bestimmte Emotionen und auch Handlungen zu evozieren, verändern – bewusst oder unbewusst – Wortschatz und Grammatik je nach aktueller Stimmung, und zudem wandelt sich auch unser Sprachgebrauch im Laufe der Jahre. Die Nachwuchsforschergruppe überträgt die Beobachtungen der modernen Soziolinguistik zur internen sprachlichen Variabilität in die Sprachgeschichte und stellt sich die Frage, ob auch historische Schreiberinnen und Schreiber sprachliche Flexibilität zeigten. Inwiefern passten sich diese also den erforderlichen schriftsprachlichen Normen unterschiedlicher Textsorten und Verschriftungssituationen an? Waren sie sich dieser Anpassungen bewusst und darüber hinaus auch in der Lage, aktiv ihre Sprachwahl zu steuern? Fokus soll hierbei weniger auf privilegierten und höher gebildeten Personen liegen denn auf dem Großteil der Bevölkerung, also ‚einfachen Schreibern‘ mit geringerer Schulbildung und bäuerlichen sowie handwerklichen Berufen. Als Datengrundlage dienen hauptsächlich Briefe und weitere persönliche Dokumente von ehemaligen Patientinnen und Patienten psychiatrischer Anstalten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. In diesen Institutionen, die im Zuge der Institutionalisierung der Psychiatrie im 19. Jahrhundert in großer Anzahl in den deutschen Ländern entstanden sind, herrschte die Praxis, bestimmte Briefe nicht abzuschicken, sondern den Patientenakten beizulegen, wo diese seitdem meist unbeachtet schlummern. Im Forschungsprojekt widmen wir uns diesen Briefen aus interdisziplinärer Perspektive und erstellen zunächst ein elektronisches und frei zugängliches Briefkorpus mit Material aus Süddeutschland (psychiatrische Anstalt Irsee/Kaufbeuren), Norddeutschland und Großbritannien (siehe http://copadocs.de). Dieses untersuchen wir anschließend hinsichtlich der Hypothese, dass auch ‚einfache Schreiber‘ sich bewusst für den Einsatz unterschiedlicher sprachlicher Register und damit auch unterschiedlicher (Bündel von) Varianten entscheiden konnten. Das Forschungsprojekt entwickelt dabei Methoden zur Kombination funktionaler mit strukturellen Herangehensweisen an sprachliche Variation und schließt an eine integrative Theoriebildung in der Variationsforschung an. Die Spezifik dieses Korpus erlaubt es darüber hinaus, den Einfluss von Alter und/oder Krankheiten auf den Sprachgebrauch zu analysieren, und leistet dabei Pionierarbeit im Bereich einer Historischen Patholinguistik. Ethische Relevanz erhält das Projekt durch die Untersuchung von Textbewertungen, der Zensurpraxis und der Legitimation von Wissen und Macht – schließlich ergreifen die Patienten mit ihren Erfahrungen im psychiatrischen Kontext nun selbst das Wort, welches ihnen damals verwehrt wurde. Die Nachwuchsforschergruppe besteht aus dem Gruppenleiter sowie sechs Doktoranden, und ist angegliedert an den Elitestudiengang „Ethik der Textkulturen“ der Universitäten Erlangen und Augsburg.Übersetzungskultur in der Frühen Neuzeit. Textgenese und Variation in Luthers Bibelübersetzung
(FAU Funds)Laufzeit: 1. Januar 2017 - 30. April 2018Germanistische Institutspartnerschaft (Erlangen – Porto Alegre/Pelotas (Brasilien), DAAD)
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: seit 1. Januar 2017
Mittelgeber: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)Germanistische Institutspartnerschaft (Erlangen – Porto Alegre/Pelotas (Brasilien), DAAD)
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 2017 - 31. Dezember 2022
Mittelgeber: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)Grammatische Terminologie
(Projekt aus Eigenmitteln)Laufzeit: seit 1. Januar 2016Zusatzqualifikation Wirtschaft für Lehramtsstudierende
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Juli 2015 - 31. Dezember 2017
Mittelgeber: Bayerische StaatsministerienGermanistische Institutspartnerschaft (Erlangen – Porto Alegre/Pelotas (Brasilien), DAAD)
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 2013 - 31. Dezember 2016
Mittelgeber: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)Fränkisches Wörterbuch
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: seit 1. Oktober 2012
Mittelgeber: andere Förderorganisation
URL: https://wbf.badw.de/das-projekt.htmlFränkisches Wörterbuch
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Siehe https://www.wbf.badw.de/das-projekt.htmlBearbeitung des Buchs "Jesus Sirach" in der Luther-Bibel 1984
(Drittmittelfinanzierte Gruppenförderung – Teilprojekt)Titel des Gesamtprojektes: Überarbeitung der Luther-Bibel 1984
Laufzeit: 31. März 2011 - 31. Dezember 2015
Mittelgeber: andere FörderorganisationDie Melusine des Thüring von Ringoltingen in der deutschen Drucküberlieferung von ca. 1473/74 bis ins 19. Jahrhundert – Buch, Text und Bild
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 2007 - 28. Dezember 2012
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Im Mittelpunkt steht die »Melusine« des Thüring von Ringoltingen als (gedrucktes) Buch, wie es der spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Buchhändler plante, verlegte und vertrieb und wie es der Käufer und Leser in Händen hielt und rezipierte. Arbeitsgrundlage ist die Erfassung, Beschreibung und Analyse der Drucküberlieferung vom Basler Erstdruck des Druckerverlegers Bernhard Richel um 1473/74 bis zum Ende der Volksbuch-Ausgaben in den 1870er Jahren. Die Analyse schreibdialektaler, stilistischer und rhetorischer Kennzeichen, der Art und Funktion der Bilder (Bildzyklen) im Buch und auf dem Titelblatt, ihrer Ikonografie, der Rolle der verschiedenen Bildurheber und Produzenten im Buchherstellungsprozess sowie die Ausstattung und Typografie des Buches, welche die gesamte Materialität des Buchkörpers umfasst, ist das forschungsrelevante Gesamtziel. über fast vier Jahrhunderte hinweg sollen die Wechselwirkungen zwischen Buchproduktion, Buchgestalt, Textgestalt, Lesen und Leser erschlossen werden. Das Projekt ist interdisziplinär angelegt. Buchwissenschaft (Buchgestaltung, Buchhandel, Publikum und Markt), Lesegeschichte (Layout, Leseweisen und Lektürepraktiken), Sprachgeschichte (Sprachwandel vom 15. bis 19. Jahrhundert, Textorganisation, Druckersprachen) und Kunstgeschichte (Bild- und Mediengeschichte, Text-Bild-Beziehungen, Bild-Lektüre, Transferprozesse) bringen ihre jeweils spezifischen Fragen und Methoden ein.Germanistische Institutspartnerschaft mit der Ivan Franko Universität Lwiw (Lemberg) in der Ukraine
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. August 2004 - 31. Dezember 2017
Mittelgeber: Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)Die Ziele des GIP-Programms waren dieStärkung und der Ausbau der dortigen Germanistik, die Ergänzung undModernisierung der Lehre, die Unterstützung der Curriculum-Reform in der UkrainischenGermanistik, die Förderung junger ukrainischer WissenschaftlerInnen, dieWeiterbildung ukrainischer GermanistInnen, gemeinsam durchgeführteForschungsvorhaben, die Förderung des Studierendenaustausches, die Integrationder Lwiwer Germanistik in die europäische Fachkultur und eine verbesserteAußendarstellung der Lwiwer Germanistik. Diese Ziele sind im Projektzeitraumweitgehend erreicht worden. Es gab einen personellen Austausch mit etwa 50Reisen von fast 25 Dozenten nach Lwiw, ca. 60 ukrainischen Doktoranden nachErlangen, über 60 Reisen von Dozenten nach Erlangen sowie fast 50 mehrwöchigeAufenthalte Studierender in Erlangen und von 20 Tutoren in Lwiw. Darüber hinausist die dortige germanistische Bibliothek zu einer landesweit führendenausgebaut worden, ist moderne Hardware geliefert worden, sind in Kooperationaktuelle Lehrwerke erstellt worden und sind zahlreiche Stipendien an Nachwuchswissenschaftlerdurch andere Geldgeber unterstützt worden.Wortbildung in der deutschen Urkundensprache des 13. Jahrhunderts - das Verb
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 2002 - 15. September 2006
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Das Projekt soll einen Beitrag zur Erforschung der mittelhochdeutschen Wortbildung leisten. Es stellt zugleich einen wesentlichen Baustein zur Beschreibung der mittelhochdeutschen Grammatik auf der Grundlage der lange Zeit vernachlässigten Prosatexte dar. Für die drei Hauptwortarten Substantiv, Verb und Adjektiv erfolgt eine systematische historisch-synchrone Analyse der derivativen Wortbildung. Die Untersuchung basiert auf dem 'Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300' und gliedert sich in einen methodisch-theoretischen Teil und einen empirischen Teil. In der Wortbildungsanalyse werden zunächst die morphologischen Typen der Substantiv-, Adjektiv- und Verbderivation, sodann die Funktionstypen und Funktionsklassen beschrieben und schließlich mit dem frühneuhochdeutschen und gegenwartssprachlichen Wortbildungssystem verglichen, um somit Aufschluß über Entwicklungstendenzen in diesen Bereichen der deutschen Wortbildung zu erhalten.Retrodigitalisierung des "Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300"
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 2002 - 31. Dezember 2004
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
URL: http://tcdh01.uni-trier.de/cgi-bin/iCorpus/CorpusIndex.tclWortbildung in der mittelhochdeutschen Urkundensprache - das Substantiv und das Adjektiv
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 16. August 2001 - 15. September 2006
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Adjektivderivation im Nürnberger Frühneuhochdeutsch um 1500
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 1997 - 31. Dezember 2000
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 1991 - 31. Dezember 1995
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)Sprachatlas von Mittelfranken
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 1989 - 31. Juli 2007
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (StMWFK) (bis 09/2013)Der Sprachatlas von Mittelfranken dokumentiert die Dialekte des bayerischen Regierungsbezirks Mittelfranken in umfassender Weise im Bereich des Laut- und Formensystems und des Wortschatzes. Einer der acht Sprachatlasbände stellt die Sprachentwicklung im Nürnberger Ballungsraum unter soziolinguistischem Aspekt dar. Der Sprachatlas von Mittelfranken ist Teilprojekt des je zur Hälfte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Bayerischen Wissenschaftsministerium geförderten Gemeinschaftsvorhabens 'Bayerischer Sprachatlas' mit folgenden Teilprojekten: Spachatlas von Bayerisch-Schwaben (Augsburg), Sprachatlas von Mittelfranken (Erlangen), Sprachatlas von Unterfranken (Würzburg), Sprachatlas von Nordostbayern (Bayreuth), Sprachatlas von Niederbayern und Sprachatlas von Oberbayern (Passau). Die Erhebung der Sprachdaten durch geschulte Sprachwissenschaftler anhand eines ausführlichen Fragebuches (2000 Fragen zur Phonologie, Morphologie und Lexik) wurde in der ersten Projektphase 1990-1996 durchgeführt. Die Antworten der Informanten wurden dabei in phonetischer Umschrift aufgezeichnet und in der Arbeitsstelle des SMF in einer EDV-Kodierung abgespeichert. Diese Daten wurden in Sprachkarten ausgewertet. Das Ziel des Sprachatlas von Mittelfranken ist es, in Weiterentwicklung früherer deutscher Sprachatlanten durch die Verbindung von Sprachkarte, Kommentar und Belegteil eine erklärende Dialektdokumentation zu geben, die nicht in Bibliotheken verstaubt, sondern Ausgangspunkt künftiger Dialektforschung und Dialektpflege in Mittelfranken wird. Die acht Bände erschienen 2004-2014 unter dem Reihentitel Sprachatlas von Mittelfranken, hg. von Horst Haider Munske und Alfred Klepsch.Wortbildung des Nürnberger Frühneuhochdeutsch um 1500
(Drittmittelfinanzierte Einzelförderung)Laufzeit: 1. Januar 1985 - 31. Dezember 1990
Mittelgeber: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Die Publikationen sind bei den einzelnen Personen am Lehrstuhl verzeichnet.
- Bastian Führer: Aktionsarten diachron. Neuigkeiten aus der diachronen Wortbildungsforschung mit Präfix- und Partikelverben des Deutschen.
(Vortrag)
25. Juli 2024, Veranstaltung: Tag der Forschung 2024, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Mechthild Habermann: GGSG-Tagung "Sprache, Reformation, Konfessionalisierung"
(Organisation einer Tagung / Konferenz)
27. September 2017 - 30. September 2017, Erlangen - Sebastian Kürschner, Karin Rädle, Grit Nickel: Bayerisch-österreichische Dialektologentagung "Dialektale Daten: Erhebung – Aufbereitung – Auswertung"
(Organisation einer Tagung / Konferenz)
28. September 2016 - 1. Oktober 2016, Erlangen
- Interdisziplinäres Zentrum für Lexikografie, Valenz- und Kollokationsforschung: Im IZLVK sind Erlanger Wissenschaftler der Fächer Angewandte Sprachwissenschaft, Anglistik: Linguistik, Außereuropäische Sprachen und Kulturen, Computerlinguistik, Deutsch als Fremdsprache, Didaktik der englischen Sprache und Literatur, Germanistische Sprachwissenschaft, Informatik: Künstliche Intelligenz und Neurochirurgie zusammengeschlossen.
- Interdisziplinäres Zentrum für Dialekte und Sprachvariation: Das IZD bündelt dialektbezogene Projekte Erlanger Wissenschaftler aus Fächern verschiedener Fakultäten (Philosophische, Technische, Naturwissenschaftliche F.).
- Interdisziplinäres Zentrum für Digitale Geistes- und Sozialwissenschaften: Das IZdigital will die an der FAU vielfach verstreuten Forschungsinteressen in der Querschnittsdisziplin der Digital Humanities and Social Sciences department- und fakultätsübergreifend in einem Kompetenz- und Kommunikationszentrum bündeln und allgemein zur Förderung der digitalen Geistes- und Sozialwissenschaften an der FAU beitragen.
- Interdisziplinäres Zentrum für Mittelalter- und Renaissancestudien: Das IZEMIR koordiniert und fördert die vielfältigen Aktivitäten und Initiativen der Erlanger Mittelalter- und Frühneuzeitforschung.
- Interdisziplinäres Zentrum für Editionswissenschaften: Das IZED koordiniert und organisiert fächerübergreifend und im engen Schulterschluss zwischen Geisteswissenschaften und Informatik Forschung, Lehre und Weiterbildung im Bereich der Editionswissenschaft.
- Fränkisches Wörterbuch: Projekt der Kommission für Mundartforschung bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- Sprachatlas von Mittelfranken: Das Forschungsprojekt SMF dokumentiert die geographische Verteilung der Dialekte des Regierungsbezirks Mittelfranken.
- Wissenschaftliches Netzwerk Kobalt-DaF: Korpusbasierte Analyse von Lernertexten für Deutsch als Fremdsprache
Rund um Linguistik
- Institut für Deutsche Sprache: Das Institut ist die zentrale außeruniversitäre Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation der deutschen Sprache in ihrem gegenwärtigen Gebrauch und in ihrer neueren Geschichte. Die verschiedenen Abteilungen des IDS verfolgen überwiegend längerfristige Projekte, die die Arbeit in größeren Forschungsgruppen erforderlich machen. Unter anderem:
- COSMAS II: Mit Cosmas II können Textkorpora von insgesamt mehreren Milliarden Wortformen durchsucht werden.
- grammis: Grammatisches Informationssystem
- DWDS: Das Digitale Wörter der deutschen Sprache bündelt nicht nur verschiedene Wörterbücher, sondern bietet auch Zugriff auf verschiedene große Textkorpora.
- DTA: Das Deutsche Textarchiv ist ein großes deutschsprachiges Korpus aus Texten von ca. 1600 bis 1900.
- OWID: Online-Wortschatz-Informationssystem
- LinguistList: Nach eigenen Angaben „The world’s largest online linguistic resource“.
- StuTS: Studentische Tagung Sprachwissenschaft – Einmal pro Semester findet eine von Studierenden organisierte Tagung statt, auf der sich alles um die (nicht nur germanistische) Linguistik dreht.
- Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Online: Online-Version der Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (beim Verlag De Gruyter).
Recherche und Information
- UB Erlangen: Die Universitätsbibliothek stellt auf ihrer Internetseite verschiedene Dienste zur Verfügung, etwa:
- OPAC: Online-Katalog von Haupt- und Teilbibliotheken.
- Datenbanken (DBIS): Datenbanken der UB (Fachgebiete: Germanistik, Niederländische Philologie, Skandinavistik sowie Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft). Die Datenbanken sind teilweise nur über das Uni-Netz erreichbar. (Via Uni Regensburg.)
- E-Journals: Online-Zeitschriften (via Uni Regensburg).
- Informationsdienst Wissenschaft: Aktuelle Meldungen aus der Forschung.




